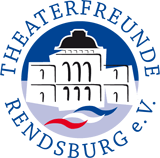Wir sind keine Theaterkritiker.
Wir werden daher die Nachkritik auf unserer Website nicht weiterführen.
Im link www.nachtkritik.de kann jede/r Interessierte direkt zugreifen.
Gehen Sie ins Theater und sehen Sie sich die Vorstellungen selbst an. Dann können Sie sich eine eigene Meinung bilden.
Nachtkritik: Leser*innenkritiken: Eine Woche voller Samstage (SHL, RD)
#981 Reiner Schmedemann 10.11.2025 23:13
Jörg Gades Inszenierung von Paul Maars Klassiker „Eine Woche voller Samstage“ verwandelt die Bühne in ein quirliges, farbenfrohes Spektakel, das Kinder begeistert und Erwachsene zum Schmunzeln bringt. Das Weihnachtsmärchen, gespielt von einem spielfreudigen Ensemble, überzeugt durch Tempo, Witz und ein klares Gespür für die Fantasiewelt des Autors – bleibt aber nicht ganz frei von Überzeichnung.
Das Bühnenbild von Martin Apelt ist ein echter Hingucker: Eine Rückwand in kräftigem Rot, Gelb und Grün erinnert mit ihrer pixelhaften Struktur an eine überdimensionale Kinderzeichnung. Der knallrote Vorhang, bewusst als sichtbares Mittel brechtscher Prägung eingesetzt, wird Teil des Spiels und gibt dem Ganzen eine charmante theatralische Metaebene. Auch die Kostüme sind ein Fest der Farben – grell, kontrastreich und bis ins Detail charakterbetont. Sie verleihen jeder Figur eine klare Kontur und unterstützen das energiegeladene Bühnengeschehen.
Im Mittelpunkt steht das Sams, gespielt von Imke Frieda Sander, die mit unbändiger Spielfreude, frechem Witz und körperlicher Präsenz überzeugt. Ihr Sams ist laut, wild und liebenswert – genau die Art anarchische Kraft, die Maars Geschichte trägt. Jonas Nowack als Herr Taschenbier bildet den idealen Gegenpol: ein schüchterner, regelgetreuer Mann, der durch das Sams sein geordnetes Leben auf den Kopf gestellt bekommt. Die beiden tragen die Inszenierung mit perfekter Balance aus Chaos und Kontrolle.
Hannah Lucie Schlewitt als Erzählerin führt – ganz im Sinne Brechts – mit Witz, Bewegungsfreude und direkter Ansprache durch die Handlung. Sie verleiht dem Stück Struktur und hält das Publikum bei Laune, während sie immer wieder den roten Vorhang öffnet und so den Spielfluss rhythmisch gliedert.
Gade setzt konsequent auf Bewegung, Lautstärke und Geschwindigkeit – ein Ansatz, der das junge Publikum unmittelbar anspricht. Kinder ab fünf Jahren dürften sich kaum langweilen, so viel passiert in jeder Minute. Die Wortspiele, für die Paul Maar berühmt ist, geraten dabei manchmal in den Hintergrund. Für Erwachsene bleibt dennoch genug subtile Komik, um die Vorstellung mit Vergnügen zu verfolgen.
Gelegentlich übersteuert das Tempo die emotionale Tiefe des Stücks. Die leisen Momente, in denen Herr Taschenbier langsam Mut fasst, bleiben angedeutet, statt wirklich zu berühren. Doch diese Reduktion auf Rhythmus und Spielfreude ist zugleich der Kern der Inszenierung: ein bewusstes Plädoyer für Theater als sinnliches, körperliches Erlebnis.
Die Entscheidung, für das Weihnachtsstück Gäste zu engagieren, erweist sich als kluger Schachzug. Das Ensemble spielt mit sichtbarer Begeisterung und einem hohen Maß an Spiellust. Gerade diese Unmittelbarkeit – das gemeinsame Staunen, Lachen, Reagieren – macht den Reiz dieser Inszenierung aus.
Insgesamt bietet Gades „Eine Woche voller Samstage“ eine Stunde pralles, farbenfrohes Theater, das das Publikum mitreißt und unterhält. Die Mischung aus Slapstick, Situationskomik und lebendiger Bühnenästhetik trifft den Nerv junger Zuschauer, auch wenn dabei manche poetischen Zwischentöne verloren gehen.
Ein quirliges, energiegeladenes Stück Theater, das nicht pädagogisch belehrt, sondern das Staunen feiert – und damit genau das erfüllt, was gutes Kinder- und Familientheater leisten sollte: Freude, Bewegung und die Lust, sich auf Fantasie einzulassen.
NACHTKRITIK: Leserkritiken: Prinz Friedrich von Homburg, Rendsburg
#975Reiner Schmedemann 12.10.2025 15:19
Heinrich von Kleists Prinz Friedrich von Homburg gehört zu jenen Dramen, die nie ganz zur Ruhe kommen. Es kreist um die großen Fragen der Moderne: Pflicht und Freiheit, Träumen und Wachen, Gehorsam und Selbstbestimmung. In einer Zeit, in der Europa wieder über Kriegsführung, Bündnistreue und staatliche Autorität diskutiert, wirkt Kleists Text erschreckend gegenwärtig. Seine Ambivalenz ist keine Schwäche, sondern eine Zumutung – er zwingt dazu, die schmale Linie zwischen notwendiger Ordnung und entmenschlichendem Gehorsam neu zu vermessen.
W. Hofmann aber erzählt das Stück im Wesentlichen als klassisches Historiendrama. Uniformen, Pathos, höfische Gesten – alles bleibt wohlgeordnet, doch damit auch harmlos. Der Abend verliert an Energie, wo Kleist eigentlich Unruhe fordert. Der zentrale Konflikt zwischen dem träumenden Prinzen und der kalten Staatsvernunft des Kurfürsten bleibt Staffage, statt existenzielles Ringen zu werden.
A.R. Schridde gibt den Prinzen als sprunghaften Offizier, doch seine Zerrissenheit bleibt äußerlich. Von jenem inneren Aufruhr, der aus Leidenschaft und Instinkt geboren ist, spürt man wenig. Auch R. Rollins Kurfürst verharrt im Repräsentativen, ohne jene rationale Strenge zu entfalten, die Kleist zum Menetekel des blinden Gehorsams macht. So verdampft der Funke, der zwischen beiden Figuren Kleists ganze Dialektik entzünden könnte.
Überraschend lebendig wird der Abend erst, wenn Prinzessin Natalie (A. Utzelmann) auftritt. Sie verleiht der Inszenierung jene emotionale Wahrheit, die den anderen Figuren fehlt. Besonders in den Szenen des Gnadengesuchs leuchtet auf, was Kleist meinte, wenn er den Traum als Erkenntniszustand versteht: ein Zustand, in dem Gefühl und Vernunft, Macht und Mitleid sich kurz berühren dürfen.
Das Motiv des Träumens – strukturell wie symbolisch der Schlüssel zum Drama – bleibt bei Hofmann zu beiläufig. Dabei verweist gerade dieses Schweben zwischen Illusion und Wirklichkeit auf unsere Gegenwart, in der politische Wahrheiten zunehmend brüchig und medial überformt sind. Kleists Schlussfrage „Ein Traum, was sonst?“ trifft damit auch uns: Ist der Staat gerecht – oder nur autoritär mit menschlicher Fassade?
So zeigt sich in Hofmanns Inszenierung ein Widerspruch: Während die Gegenwart nach einer Auseinandersetzung mit Gehorsam, Macht und Gewissen schreit, flüchtet die Regie in historische Kulisse. Kleists Drama aber wäre heute ein Sprengsatz – ein Plädoyer gegen Kadavergehorsam, für denkenden Gehorsam, für Verantwortung vor sich selbst. Gerade diese Brisanz hätte stärker freigelegt werden können.
Ein schöner Abend des Theaters, der reich mit Applaus bedacht wurde – aber kein gefährlicher. Und gerade das wäre nötig gewesen.
Nachtkritik: Leserkritik: Deutschstunde, SHL Rendsburg
#972Reiner Schmedemann 28.09.2025 17:28
Es gibt Stoffe, die nicht altern nur ihre Schärfe ändern, weil die Zeit sich ändert. S. Lenz’ Deutschstunde gehört dazu. 1968 war der Roman ein Schlag in die tastende Erinnerungskultur der BRD, ein literarischer Störfall im Klima des Schweigens. 2025 zeigt er sich als Spiegel einer Gesellschaft, die wieder nach Ordnung ruft. Populistische Bewegungen beschwören „Pflicht-bewusstsein“, rechte Rhetorik verspricht Ordnung. In dieser Gegenwart wirkt Lenz’ Roman verstörend aktuell.
Die Bearbeitung von L. Rosenhagen und Inszenierung von S. Streifinger stellen sich der Herausforderung, den Roman nicht rein museal, sondern als Gegenwartsdiagnose zu betrachten. Sie verschränken psychologische Aspekte des Familienlebens mit der Frage nach Gehorsam und Widerstand und legen den Blick frei auf politische Bruchlinien, die unsere Gesellschaft erneut durchziehen.
Im Zentrum steht J. O. Jepsen (T. Wild), der Dorfpolizist, der das Verbot gegen den Maler Nansen mit manischer Konsequenz durchsetzt. Er ist kein dämonischer Nazi-Schurke, sondern ein Mann, der sich in seiner Pflichtbesessenheit verliert, bis ins Krankhafte. Gerade dieser psychologische Aspekt macht ihn so gegenwärtig: Gehorsam als Haltung, die jede Ideologie überdauert. Jepsens Obsession endet nicht mit dem Kriegsende – und genau darin liegt die verstörende Erkenntnis des Abends.
Interessant geraten die Frauen. Die Mutter (F. Pasch) hält unbeirrt an national-sozialistischem Gedankengut fest und lehnt das Fremde kategorisch ab. Hilke (N. F. Maak) lebt das stille Aushalten: Sie träumt, von Nansen gemalt zu werden, erträgt und passt sich an. Dieser Pragmatismus zeigt, dass Diktaturen nicht nur Täter-Geschichten sind, sondern auch derjenigen, die mitlaufen und schweigen. Hilkes Befreiung, als sie sich zu ihrem Bild bekennt, entfaltet eine stille Wucht „Stummes Schreien“, wie im Bild der Schrei von E. Munch.
Nansen (R. Schleberger) erscheint vital, leidenschaftlich, kämpferisch. Er malt trotz Malverbots, steht für Freiheit, widerständige Kunst, unbeugsames Leben, wie im Roman vorgegeben, statt Noldes Realität zu integrieren: Antisemit und Parteigänger, von den Nazis verfemt, aber nie ein Widerständler. Dieses Spannungsfeld von Verstrickung und Opposition bleibt ausgespart, wird aber im Programmheft erwähnt. So verzichtet die Inszenierung auf eine Reibungsfläche: Kunst erscheint fast zu rein, zu eindeutig als Erlösung – dabei ist sie, wie Nolde zeigt, auch ein Feld der Ambivalenz.
Siggi (S. R. Scholz) schließlich trägt die Zerrissenheit. Sein Erzählen ist tastend, widersprüchlich, manchmal rebellisch, oft ohnmächtig. Die Regie bleibt eng am Prosatext von Lenz, lässt ganze Passagen sprechen und hebt damit die literarische Qualität auf die Bühne. Siggis Stimme wird zum Resonanzraum, in dem Erinnerung, Schuld und Sehnsucht ineinandergreifen.
Die Familie Jepsen ist keine Idylle, sondern ein Labor des Gehorsams. Am Esstisch, in der Stube wird „Pflicht ist Pflicht“ eingeübt, rezitiert, mit der Inbrunst eines fanatischen Befehlsempfängers. Streifinger zeigt: Autoritäre Strukturen entstehen nicht erst im Staat, sie wachsen in den kleinen Räumen, wo Gehorsam als Tugend gilt. Das ist bedrückend, weil es vertraut wirkt – wie schnell Ordnung zum Selbstzweck, Pflicht zur Krankheit werden kann.
Das Bühnenbild von V. Hiltmann eine drehbare Wand, die Räume der Strenge von Räumen der Freiheit trennt, ergänzt von Vorhängen, die als Projektionsflächen für Nolde Gemälde dienen. Musik und Videos von A. Halka verstärken die emotionale Wahrnehmung der Konflikte.
Die Inszenierung ist kein Denkmal, sondern ein Prüfstein. Sie fordert zur Auseinandersetzung mit Gehorsam und Verantwortung, ohne einfache Antworten zu geben. Man verlässt den Saal mit dem nachhallenden Mantra „Pflicht bleibt Pflicht“. Die entscheidende Frage, wessen Pflicht es ist, bleibt offen, darin liegt die Dringlichkeit dieses Abends.
NACHTKRITIK: Leserkritiken: Kalter Weißer Mann, Rendsburg
#899Reiner Schmedemann 01.12.2024 11:14
Nachdem Erfolg „Extrawurst“ von Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob am SHL folgt nun deren neues Stück „Kalter Weißer Mann“. Das Stück hatte im April diesen Jahres seine Uraufführung am Renaissance-Theater in Berlin. Nun steht es auf den Brettern des SHL.
„Einmalig! Der Tod kommt nur einmal. Damit kann man leben!“ insbesondere, wenn man 94jährig friedlich einschläft, wie der Chef eines mittelständischen Bekleidungsunternehmens (Unterwäsche). Sein Nachfolger Horst Bohne, Geschäftsführer (Felix Ströbel) organisiert die Beisetzung. Doch die geplante Trauerfeier läuft aus dem Ruder, weil der Text der Trauerschleife zu heftigen Irritationen führt: „In tiefer Trauer. Deine Mitarbeiter“. Schnell hat der neue „alte weiße aber noch nicht kalte Mann“ (Felix Ströbel) seine Marketing-Leiterin Alina Bergreiter (Annika Utzelmann), den Social-Media-Chef Kevin Packert (Tomás Ignacio Heise) und seine Sekretärin Rieke Schneider (Illi Oehlmann) gegen sich und letztendlich auch die selbstbewusste Praktikantin Kim Olkowski (Julia Bella Berchtold). Vor uns, dem Theaterpublikum, als versammelte Trauergemeinde zerfleischt sich in dieser skurrilen Farce schließlich die Führungsmannschaft der Firma immer mehr und auch der verzweifelte Pfarrer Herbert Koch (Reiner Schleberger) kann die Wogen nicht glätten.
Es entfacht sich eine hoch aufgeladene Kulturdebatte über das Gendern, Sexismus und politisch korrektes Verhalten. Mit scharfem Blick und lustvoller Hingabe zeichnen die Autoren die Abgründe, Fallstricke und rhetorischen Kniffe der aktuellen Diskussion über soziale Umgangsnormen und ihre menschlich-allzu-menschlichen Ursachen. Wecken aber auch die Sehnsucht nach aufmerksamen und respektvollen Umgang miteinander.
Die Inszenierung am SHL übernimmt Jörg Gade im Bühnenbild und Kostümen von Martin Apelt. Das Bühnenbild dem Anlass angemessen eine Bestattungskapelle in grau gehaltenen Marmortönen und die Trauergemeinde in schwarzem Outfit – düster, trostlos und konventionell. Jörg Gade nimmt den Comedian Lobrecht beim Wort: „Gender-Sternchen! Super, endlich sind auch Stars wie ich mitgemeint.“ und legt einen amüsanten, teils bissigen Abend der woken Community aufs Parkett.
Gade inszeniert den Abend als temporeichen Schlagabtausch mit viel Wortwitz und verblüffenden Umkehrungen, der für beide Positionen Sympathie und Verständnis weckt – ohne zu belehren.
Herrlich F. Ströbel als Bohne, der seine traditionellen Einstellungen vom „Zipfelchen“ bis zu den „Hottentotten“ teils verzweifelt verteidigt und in jedes Fettnäpfchen, das sich ihm bietet, hineintritt und so zwischen die Fronten des aggressiv ausgetragenen Kulturkampfes gelangt. Felix Ströbel wird durch sein facettenreiches Spiel mit genialer Mimik und Gestik zum Star des Abends.
I. Ohelmann als Rieke, die von den woken Debatten so gar nichts versteht und mit ihren hinreißend dämlichen Kommentaren das Publikum zum Lachen bringt ist der zweite schauspielerische Höhepunkt des Abends, da sie die Pointen auf den Punkt setzt.
A. Utzelmann als Alina, bissig und nie um das letzte Wort verlegen, entpuppt sich als autoritäre und machtgeile Person wie die angeprangerte „alte weisse Männerwelt“.
T.I. Heise als Kevin, gibt den coolen, überzeugend woken „Instagramer“ im Fahrwasser der dominanten Alina.
J.B. Berchtold als Kim, junge Revoluzzerin und toughe Nervensäge, die sich schon als Praktikantin um ihre Work-Live-Balance sorgt.
Last but not least Reiner Schleberger als Pfarrer Koch, der mit seiner Kreuzungsgeschichte nicht zu Potte kommt.
Erneut zeigt sich: Am SHL formt sich unter der Intendantin ein Ensemble und man kann nur hoffen das diese Entwicklung weiterwächst.
Das Stück zeigt eindrucksvoll, dass nicht nur der Umgang der Geschlechter komplizierter wird, sondern auch das Minenfeld zwischen Boomern und Generation Z explosiver ist, als viele vermuten. Dennoch ist „Kalter weißer Mann“ ein amüsantes Plädoyer für mehr Gelassenheit und Toleranz. Dem Publikum hat die Gesellschaftssatire bestens gefallen.